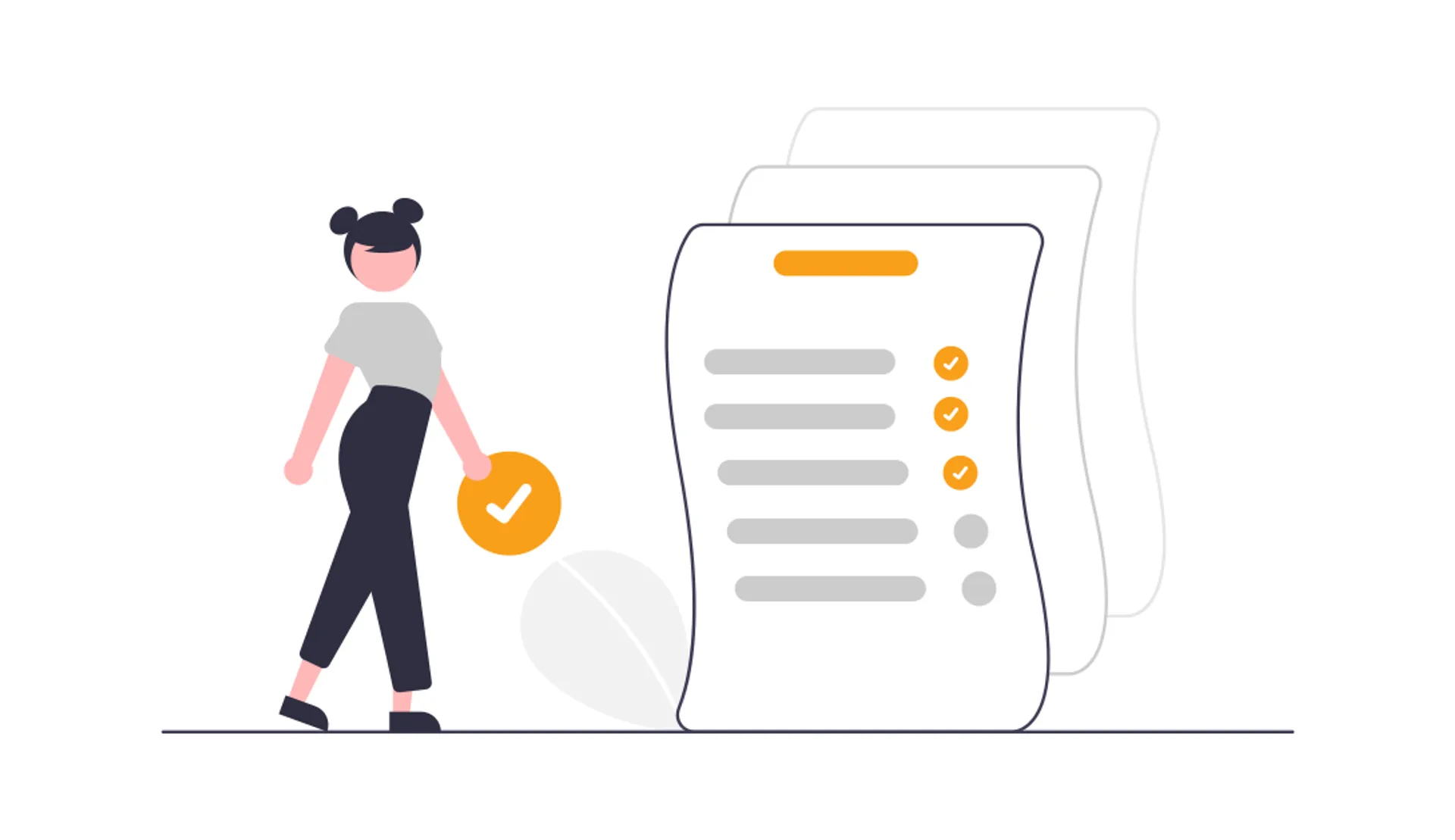Strategischer Projektplan für die Ablösung von CMS und Redaktionssystemen
Viele Unternehmen stehen irgendwann vor der Herausforderung: Das bestehende Redaktions- oder Content-Management-System stößt an seine Grenzen. Inhalte wachsen, Produkte werden komplexer, Übersetzungsanforderungen steigen und das alte System kommt nicht mehr hinterher. Die Folge sind steigende Kosten, ineffiziente Workflows und Frust in den Redaktionen.
Ein Systemwechsel ist jedoch kein Routine-Upgrade, sondern ein strategisches Transformationsprojekt. In diesem Beitrag skizzieren wir einen Projektplan, der sich in vielen Ablöseszenarien bewährt hat, und zeigen, wie Entscheider Risiken minimieren und die Weichen für eine zukunftsfähige Content-Architektur stellen können.
1. Bestandsaufnahme: Klarheit über die Ausgangslage schaffen
Am Anfang jedes Ablösungsprojekts steht die gründliche Analyse der Ist-Situation. Ein Redaktionssystem ist selten „von der Stange“, sondern in der Regel stark an die Bedürfnisse des Unternehmens angepasst. Deshalb gilt es zunächst, die vorhandenen Daten genau zu analysieren: Welche Inhalte sind vorhanden, in welchen Strukturen liegen sie vor, und wie konsistent sind sie? Gerade in älteren Systemen findet man häufig gewachsenen Wildwuchs, der bei einer Migration Probleme verursachen kann. Ebenso wichtig ist die Analyse der bestehenden Workflows: Wo entstehen neue Produkte, wie werden Daten gepflegt, und welche Abteilungen sind in die redaktionellen Prozesse eingebunden? Hinzu kommt die Betrachtung der Ausgabekanäle: Werden PDFs exportiert, Translation-Memory-Systeme beliefert, Inhalte in Shops oder auf Partnerportalen ausgespielt?
Diese Fragen zeigen, welche Systemlandschaften berücksichtigt werden müssen. Schließlich sollte auch eine Stakeholder-Analyse erfolgen: Wer arbeitet mit dem System, wer ist betroffen, und welche Rollen spielen Redaktion, IT, Übersetzung oder Service im künftigen Projekt?
2. Proof of Concept oder Pilot: Realistische Tests statt Theorie
Nach der Analyse folgt die erste Annäherung an das neue System. Ein Proof of Concept (PoC) dient dazu, die Funktionalität praxisnah zu erproben, ohne gleich die gesamte Organisation umzustellen. Typischerweise wird dazu eine Produktgruppe ausgewählt, deren Inhalte in das neue System migriert werden. Dabei geht es ausdrücklich nicht darum, die alten Strukturen 1:1 nachzubilden. Stattdessen ist der PoC die Gelegenheit, überfällige Bereinigungen vorzunehmen, Datenstrukturen zu harmonisieren und Dubletten zu entfernen.
Ein solcher Test macht sehr schnell sichtbar, wie sich das neue System im Alltag bewährt und welche Anpassungen noch nötig sind. Besonders wertvoll ist die ganzheitliche Betrachtung des gesamten Erstellungs- und Publikationsprozesses – von der Generierung der Daten bis zum Export. Inhalte werden dabei nicht nur importiert, sondern auch in einem Zielkanal ausgegeben, etwa als PDF oder Online. Dadurch lässt sich beurteilen, ob die Datenflüsse von der Quelle bis zur Publikation funktionieren.
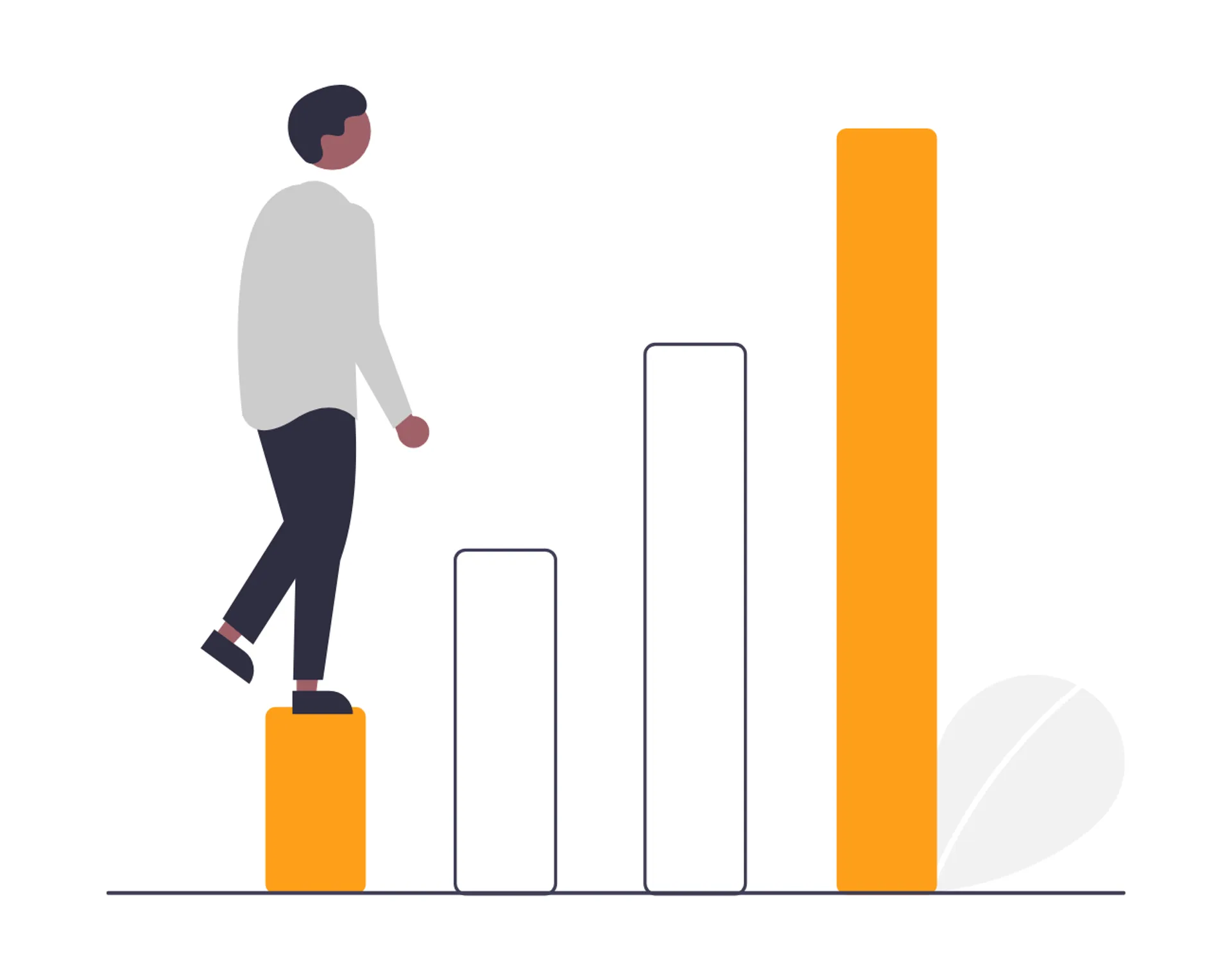
PoC vs. Pilot: Unterschiede
Ein Proof of Concept (PoC) überprüft in erster Linie die Machbarkeit. Er ist – anders als ein Pilot – nicht dafür gedacht, später weiterverwendet zu werden. Inhalte, Testdaten und Konfigurationen werden am Ende in der Regel verworfen, damit der eigentliche Start mit einem sauberen System erfolgen kann.
Ein Pilotprojekt hingegen bildet die Grundlage für die spätere Einführung und Weiterentwicklung. Der Aufwand ist höher, weil Datenmodelle, Schnittstellen und Workflows bereits produktionsnah eingerichtet werden müssen. Der Vorteil: Auf den im Piloten gepflegten Daten und Strukturen lässt sich direkt aufbauen – man startet also nicht mehr bei null, wie es beim PoC der Fall ist.
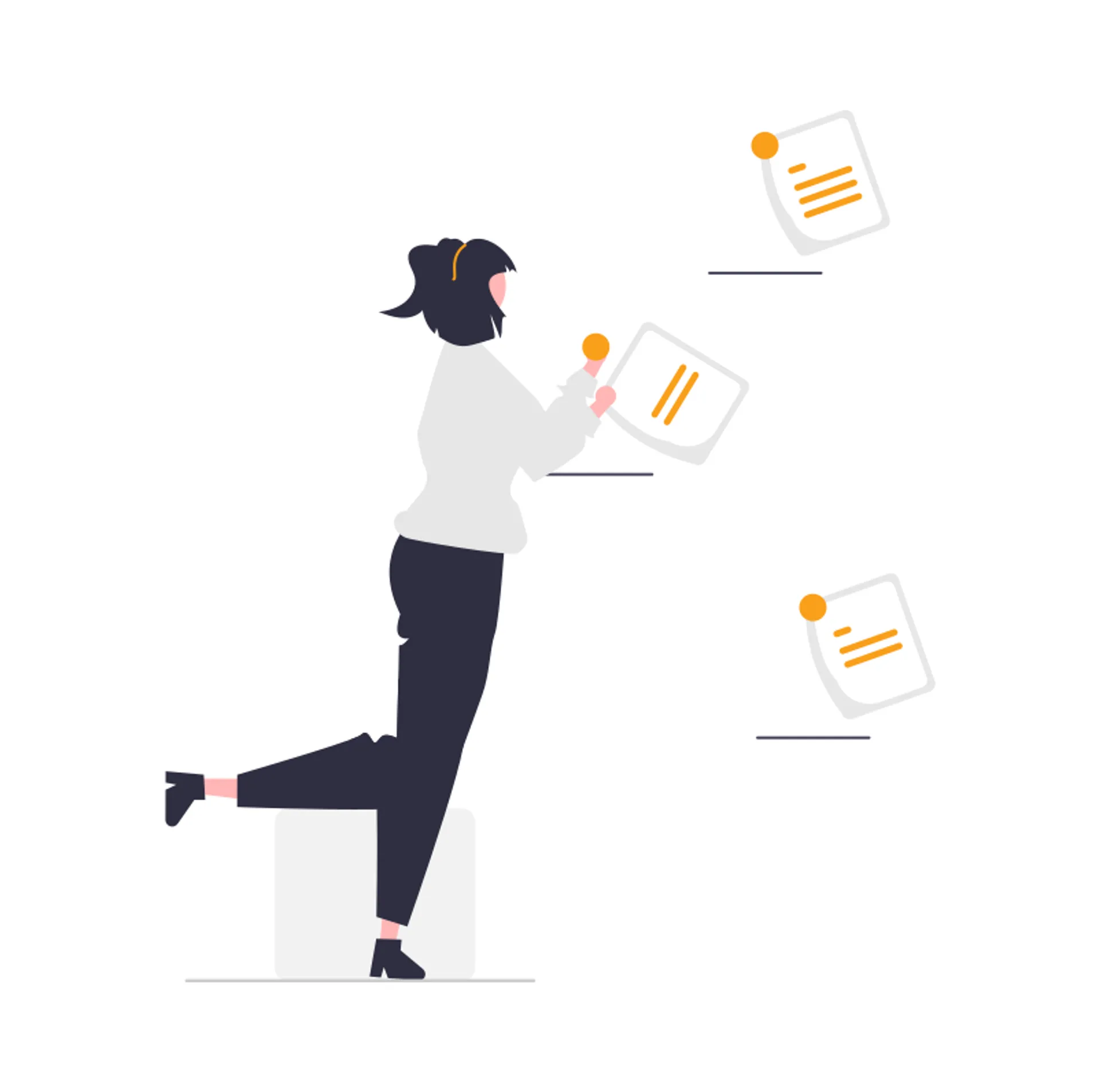
3. Migration und Integration: Schritt für Schritt statt Big Bang
Auf Basis der Erfahrungen aus dem PoC folgt die eigentliche Migration. Hier hat sich ein schrittweises Vorgehen bewährt. Zunächst werden die bestehenden Inhalte in größerem Umfang importiert. Wichtig ist, dies nicht als einmalige Aktion zu betrachten, sondern den Prozess so zu gestalten, dass auch regelmäßige Datenimporte möglich sind. Schließlich entstehen in der Zwischenzeit laufend neue Inhalte.
Parallel dazu werden die konsumierenden Systeme angebunden – etwa E-Commerce-Plattformen, Websites oder Serviceportale. Ein kritischer Erfolgsfaktor ist der Parallelbetrieb: Für eine Übergangszeit laufen altes und neues System nebeneinander. Neue Inhalte werden jedoch ausschließlich im neuen System gepflegt, während das alte System noch die Bestandsdaten liefert, die noch nicht migriert wurden. So vermeidet man eine Doppelpflege und behält zugleich ein Sicherheitsnetz. Sollte es zu Problemen im neuen System kommen, kann kurzfristig zurückgeschaltet werden.
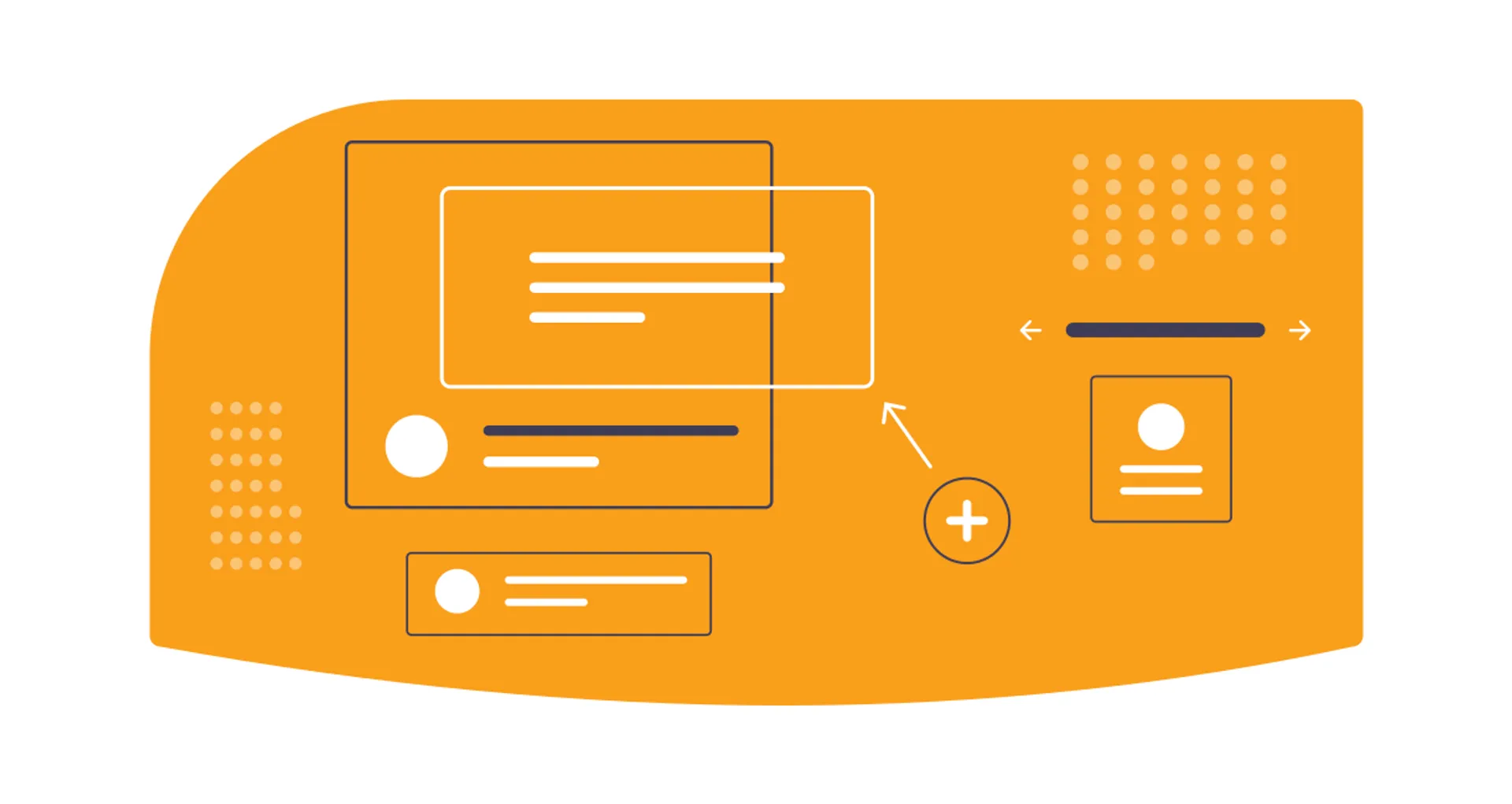
4. Rollout: Strukturierte Einführung statt Chaos
Beim Rollout geht es darum, das neue System schrittweise in den produktiven Betrieb zu bringen. Eine Einführung in klar abgegrenzten Phasen hat sich bewährt – beispielsweise mit einer spezifischen Produktpalette oder einem zusätzlichen Ausgabekanal. Solche Quick Wins machen den Nutzen schnell sichtbar und sorgen dafür, dass das Vertrauen in die neue Lösung wächst.
Schulungen sind in dieser Phase essenziell, damit alle Beteiligten sicher mit dem neuen System umgehen können. So lassen sich Fehler vermeiden und die Akzeptanz für die neue Arbeitsweise erhöhen.

5. Risiken und Stolpersteine: Typische Hürden kennen
Datenverlust und Konvertierungsfehler
So gut ein Projekt auch vorbereitet ist – es gibt Fallstricke, die regelmäßig auftreten. Ein Risiko ist der Datenverlust oder Konvertierungsfehler bei der Content-Migration. Ohne gründliche Validierung fallen Lücken oft erst Jahre später auf.
Unklare Zielarchitektur
Ebenso problematisch ist eine unklare Zielarchitektur: Wenn nur kurzfristige Symptome adressiert werden, ohne eine strategische Roadmap zu verfolgen, entsteht das nächste Problem bereits beim Start.
Kostenexplosion durch Feature-Wunschlisten
Hinzu kommt die Gefahr der Kostenexplosion. Sie tritt dann auf, wenn Projekte von Feature-Wunschlisten getrieben werden, statt von klar definierten Anforderungen.
Unrealistische Erwartungen
Ein weiteres Risiko sind unrealistische Erwartungen an die Leistungsfähigkeit des neuen Systems. Wer von vornherein zu viel fordert, überfordert oft nicht nur das Budget, sondern auch die beteiligten Teams.
Verzögerungen durch zu viele Funktionen
Ein häufiger Grund, warum sich Projekte verzögern können, ist der Versuch, gleich zu Beginn möglichst viele neue Funktionen umzusetzen. Wer sämtliche Sonderwünsche in die erste Projektphase packt, läuft Gefahr, nie zu einer stabilen Einführung zu gelangen.
MVP mit Augenmaß
Zielführender ist es, sich auf ein sogenanntes Minimum Viable Product (MVP) zu konzentrieren, also eine erste Version mit den Kernfunktionen, die wirklich notwendig sind, um produktiv mit dem System arbeiten zu können.
Dabei ist es wichtig zu beachten, dass ein MVP nicht auf das absolute Minimum reduziert werden darf. Einige Quality of Life Funktionen, die den Arbeitsalltag der Anwender erleichtern, sollten von Anfang an enthalten sein. Sie sichern nicht nur die Akzeptanz, sondern tragen auch dazu bei, dass die tägliche Arbeit als angenehm und motivierend empfunden wird. Ein System, das Spaß macht und positive Nutzungserfahrungen bietet, wird viel schneller angenommen. Weitere Funktionen lassen sich anschließend Schritt für Schritt ergänzen. Dieses Vorgehen hält das Projekt beherrschbar, sorgt für schnelle Erfolge und stärkt zugleich die Motivation im Team.
6. Best Practices: Erfolgsfaktoren aus Projekterfahrung
Stakeholder frühzeitig einbinden
Aus zahlreichen Ablösungsprojekten lassen sich wiederkehrende Erfolgsfaktoren ableiten. Zunächst ist die frühzeitige Einbindung aller Stakeholder unverzichtbar – von der Redaktion über IT und Übersetzung bis hin zur Rechtsabteilung. Besonders wichtig ist dabei, die Redakteure und Content-Manager als Hauptanwender von Anfang an ins Projekt einzubinden. Sie sind die täglichen Nutzer des Systems und kennen die Herausforderungen im Detail. Wenn sie ihre Perspektive frühzeitig einbringen können, steigt die Qualität der Anforderungen und die Akzeptanz im späteren Betrieb erheblich.
Proof of Concept oder Pilotprojekt nutzen
Eine weitere zentrale Empfehlung ist der Proof of Concept oder ein Pilotprojekt. Sie sind das risikoärmste Instrument, um Unsicherheiten frühzeitig auszuräumen. Durch die Arbeit mit echten Daten in einem begrenzten Rahmen lassen sich Schwachstellen schnell identifizieren, ohne dass gleich ganze Abteilungen betroffen sind. Sie schaffen Transparenz, reduzieren Ängste im Team und verhindern, dass Probleme erst nach dem Go-Live sichtbar werden.
Fokus auf Datenmodell und phasenweise Einführung statt Big Bang
Auch eine phasenweise Einführung hat sich bewährt: Kleine Schritte mit sichtbaren Erfolgen halten die Motivation hoch und erleichtern den Übergang. Besondere Aufmerksamkeit sollte dem Datenmodell gelten. Ein sauberes, medienneutrales Content-Modell zahlt sich langfristig in allen Prozessen aus. Schließlich ist es ratsam, schon bei der Systemauswahl auf moderne Architekturprinzipien zu achten. Headless- und API-first-Ansätze erleichtern die Integration, Modularisierung und künftige Erweiterungen.
Fazit
Die Ablösung eines Redaktionssystems oder CMS ist weit mehr als ein Softwarewechsel. Sie ist ein Transformationsprojekt, das Daten, Technik, Prozesse und Organisation gleichermaßen betrifft. Wer den Weg systematisch geht – von der Bestandsaufnahme über einen Proof of Concept oder Piloten bis hin zu Migration und Rollout – schafft nicht nur ein neues System, sondern ein Fundament für die nächsten Jahre.
Entscheidend für den Erfolg ist dabei die Balance zwischen technischer Machbarkeit und organisatorischer Akzeptanz und zwischen kurzfristigen Erfolgen und langfristiger Strategie. Gelingt diese Balance, wird aus einem schwierigen Ablöseprojekt eine echte Chance zur Modernisierung und Effizienzsteigerung.